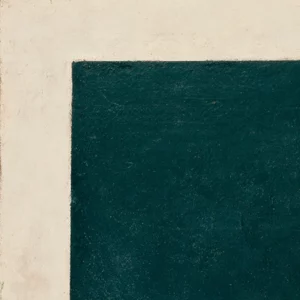Seit ein paar Wochen gehe ich tauchen. Jeden Tag um halb zwölf knarzt ein „Wir fahren los!“ aus der Steuerzentrale und es geht in der kleinen Kapsel hinab. Wir, acht Studienteilnehmende, verlassen nicht wirklich den Boden der Klinik – nur der Druck ändert sich, zweieinhalb Stunden atmen wir unter einem Bar, also gefühlt in zehn Metern unter der Meeresoberfläche, medizinischen Sauerstoff ein. Wir alle haben Long Covid, genauer gesagt Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS), die schwerste Form von Long Covid – eine Multisystemkrankheit, bei der die Energieversorgung des Körpers auf zellulärer Ebene nicht funktioniert.
2022, auf der Höhe der Omikron-Welle, habe ich mich angesteckt. Seitdem bin ich nicht gesund geworden. Ich bin behindert, verrentet, arbeitsunfähig, erlebe starke körperliche Schwäche, Schmerzen, Schwindel, Schlafstörungen, Herzrhythmusstörungen, bin stark reizempfindlich. Am meisten schränkt mich die sogenannte PEM ein, die post-exertionelle Malaise, eine Zustandsverschlechterung aller Symptome nach jeder Form von Anstrengung. Sie bedeutet konkret, dass ich nach einem kurzen Telefonat für eine Stunde ruhen muss, maximal alle zwei Tage das Haus verlassen kann, Sport völlig ausgeschlossen ist. Und sie bedeutet, dass jede Verschlechterung dauerhaft bleiben kann.
Obwohl vielfältige Schäden in den Körpern von Long-Covid-Betroffenen gefunden wurden, wird seit Jahren (und bei ME/CFS seit Jahrzehnten) auch öffentlich darüber gestritten, ob es sich um körperliche Erkrankungen handelt, ob die Symptome psychisch bedingt sind – oder ob sich die Betroffenen ihre Krankheit womöglich einbilden. Viele Symptome, etwa Erschöpfung und Schmerzen, lassen sich nicht mit gängigen diagnostischen Verfahren erklären, was dazu führen kann, dass Patientinnen und Patienten nicht geglaubt wird oder ihre Symptome psychologisiert werden.
Auch ich habe so ein „Medical Gaslighting“ erlebt, wenn auch verhältnismäßig moderat. An einem Tag, an dem ich nicht einmal allein ins Bad kam, erklärte mir ein Allgemeinmediziner, mit mir sei alles in Ordnung. Ein Herzspezialist, bei dem ich wegen Herzrhythmusstörungen in Behandlung war, meinte, ich solle mich entspannen. Aus der Reha kam ich mit so starken Verschlechterungen, dass ich mich monatelang nicht allein versorgen konnte. Und das, obwohl sie speziell auf ME/CFS zugeschnitten war. Doch es wurde nicht beachtet, dass das gesamte Setting einer Reha bei dem Krankheitsbild schädlich ist: Das Reinigungspersonal, das frühmorgens poltert. Die Lüftungsanlage gegenüber. Der Helikopter-Landeplatz vor den Zimmern. Der riesige, volle, laute Speisesaal. Die viel zu kurzen Pausen zwischen den Therapien. All das bedeutet Anstrengungen, die mich auch ohne weiteres Reha-Programm überfordert hätten.
Das mangelnde Verständnis von ärztlichem Personal hat – unabhängig von Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf – weitreichende Folgen: Es führt zu Fehlentscheidungen von Versicherungs- und Rententrägern sowie Gesundheitsämtern, die über den Grad der Behinderung, Pflegestufen und finanzielle Versorgung entscheiden. Das wiederum hat konkrete Auswirkungen auf den Alltag von Betroffenen. Fast alle Therapien, die mir körperliche Besserung verschaffen, muss ich selbst bezahlen. Sie sind Privilegien, abhängig davon, dass mein Umfeld mich finanziell unterstützt. Chronisches Kranksein ist nicht nur eine medizinische Kondition, es ist eingebettet in gesellschaftliche, politische und ökonomische Kontexte und verschärft oft Ungleichheiten.
Seitdem ich tauchen gehe, sind meine Symptome etwas weniger stark. Ich kann häufiger das Haus verlassen, kann länger lesen und schreiben, muss nicht so oft Pausen machen. Doch bald ist die Studie vorbei. Es werden Fragen bleiben: Wird es mir dauerhaft besser gehen? Und falls alles wieder schlimmer wird: Wie soll ich eine Behandlung, die Tausende von Euro im Monat kostet, von meiner Rente finanzieren? Was sage ich den anderen Kranken, mit denen ich in Verbindung stehe? Ja, es wirkt, aber leider müsst ihr dafür ein Vermögen aufbringen? Ich wäre so gern versöhnlich, würde von Ärztinnen und Ärzten berichten, die sich interessieren, sich in ihrer knappen Freizeit fortbilden. Aber das Siechen ist nah. Gerade musste eine Freundin mit ME/CFS ins Krankenhaus. Selbst auf der Neurologie-Station kannte niemand die Erkrankung, sie wurde in ein Vierbett-Zimmer gelegt. Für eine Person mit starker Reizempfindlichkeit ist das nicht nur eine Qual, sondern gefährlich. Eine Bekannte mit ME/CFS konnte tagelang keine Nahrung bei sich behalten. Und das, nachdem sie bereits Wochen ohne ärztliche Betreuung mit starkem Untergewicht im abgedunkelten Zimmer lag, die Augen unter einer Schlafbrille, unfähig, Licht, Geräusche oder Worte zu verarbeiten.
Ignoranz, Unwissen und Stigmatisierung können tödlich sein. Die ME/CFS-Kranke Maeve Boothby O’Neill aus England verhungerte 2021, weil ihr im Krankenhaus die nötige Versorgung verwehrt wurde. Silja Viermann aus Berlin beendete 2022 wegen schwerstem ME/CFS ihr Leben mit assistiertem Suizid. Sibylle Dahrendorf, die an der Entsteheung des Dokumentarfilmes „Chronisch krank, chronisch ignoriert“ beteiligt war, kann vor Schmerzen und körperlichem Verfall kaum noch leben. Schon vor Jahren ist sie in einen Sterbehilfeverein eingetreten. Dahrendorfs Film endet mit einem Zitat, das dem griechischen Geschichtsschreiber Thukydides zugeschrieben wird und das sich auf eine Epidemie im 4. Jahrhundert v. Chr. bezieht: „Es wird Gerechtigkeit in Athen geben, wenn diejenigen, die nicht verletzt sind, genauso empört sind wie diejenigen, die es sind.“ Allein schaffen wir Betroffene es nicht. Wir brauchen Sie, wir brauchen Euch – die Gesunden.
Zur Person
Jana Petersen, Journalistin
Als freie Autorin schreibt Jana Petersen u. a. für Zeit Online, die taz, den Tagesspiegel und Monopol. Seit ihrer Corona-Erkrankung 2022 leidet die Journalistin unter den Langzeitfolgen von Long Covid und sucht nach geeigneten Therapiemöglichkeiten für ihre Krankheit.
Mangelndes Verständnis hat weitreichende Folgen