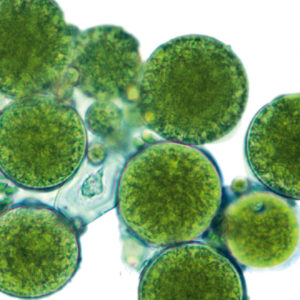Beethoven hatte einfach einen schlechten Tag, als ihm ein Strohhalm in jedes Nasenloch gesteckt, das Gesicht mit Gips eingeschmiert und einige Zeit später eine Maske abgenommen wurde. Freunde des Komponisten berichten, wie sehr Beethoven die Prozedur hasste, dass sie ihm viel zu lange gedauert und ihn wütend gemacht hätte. Das Ergebnis dieses Nachmittags schrieb indes Musikgeschichte. Fast alle Beethoven-Porträts entstanden nach Vorlage dieser Lebend-Maske. Das uns vertraute Gesicht eines Genies, so, wie es von überall herabschaut: von Plattencovern, von Spieluhren, von bunten Kaffeetassen, ja sogar vom legendären Pop-Art-Porträt von Andy Warhol und von der Werbekampagne des Beethoven-Jahres („BTVN2020“). Überall die gleichen wilden Locken, der grimmige, fast irre Blick, an dem nichts freundlich wirkt, bei dem alles nach dunkler Grübelei aussieht, nach schwerem Denken und harter Arbeit im täglichen Steinbruch der Töne.
Dabei soll Beethoven durchaus humorvoll gewesen sein. Er war sich seiner kleinen Statur und seiner großen gesellschaftlichen Rolle bewusst, soll es geliebt haben, durch die Straßen von Bonn oder Wien zu gehen und den Menschen Streiche zu spielen. Unser Beethoven-Bild ist bis heute widersprüchlich: ein Wahnsinniger, ein Genie, ein Sehnsüchtiger und ein Miesepeter – viele Klischees und wenig historische Fakten, mehr Vorstellung als Wahrheit. Um Beethoven rankt sich einer der größten deutschen Künstler-Mythen, und jede Generation fügt der ewigen Klitterung dieses Titanen ihr eigenes Bild hinzu.
Es ist fast schon ein Witz, dass ausgerechnet eines der unspektakulärsten Stücke Beethovens, die gut dreiminütige Gelegenheitskomposition „Für Elise“, zur weltweiten Erkennungsmelodie des Komponisten geworden ist, der in Wahrheit mit seiner „Sturmsonate“, der „Appassionata“ oder den „Diabelli-Variationen“ die harmonischen Regeln seiner Zeit sprengte. Diese sperrig-genialen Spätwerke haben zwar Musikgeschichte geschrieben, es aber nicht in unseren Alltag geschafft wie „Für Elise“. Das Klavierstück in Popsonglänge ist in den Telefon-Warteschleifen der Welt zu hören, und James Bond verführt dazu ein Bond-Girl. „Für Elise“ spielt eine Schlüsselrolle in Roman Polanskis Horror-Klassiker „Rosemary’s Baby“ (1968) und begleitet den Auftritt des Nazi-Schurken, gespielt von Christoph Waltz, in Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ (2009) als ironischer Soundtrack der bürgerlich-germanischen Hochkultur.
Zwischen Papieren und Weinflaschen
Generationen von kleinen Mädchen mit geflochtenen Zöpfen und Spitzenkleidern wurden auf Klavierhocker gesetzt, um mit „Für Elise“ ihren ersten „echten Beethoven“ vorzuspielen. Eine musikalische Dressur, die an Beethovens eigene Kindheit erinnert. Auch um sie ranken sich Mythen und Märchen: etwa vom ewig besoffenen Vater in Bonn, der seinen Sohn mitten in der Nacht aus dem Bett zerrte, um ihn zur Unterhaltung seiner Saufkumpanen ans Klavier zu setzen. An dieser Geschichte mag etwas dran sein, aber zur Wahrheit gehört auch, dass Beethoven seinen Vater ein Leben lang verehrte und verteidigte. Und das, obwohl er nach dem frühen Tod seiner Mutter bereits mit 17 Jahren das Vermögen der Familie verwalten musste. Dem alkoholkranken Vater traute man dies nicht mehr zu, er starb 1792 – da war Beethoven 22 Jahre alt.
Zum ewigen Beethoven-Mythos gehört auch das Bild des Genies, das seine Gegner bei Klavier-Wettbewerben in Wien mit Furor von der Bühne fegte und zu Hause als Messie lebte. Tatsächlich muss es in den mehr als 20 Wohnungen, die Beethoven in Wien bewohnte, etwas gewöhnungsbedürftig ausgesehen haben: Papiere und Weinflaschen auf dem Boden, neben alten Klamotten und halb leeren Gläsern. Chaotisch auch seine Handschriften und Skizzenbücher: Anders als Mozart, dem die Noten quasi fertig auf das Papier fielen, hat Beethoven sich an jedem Werk abgearbeitet, viele Passagen überarbeitet, durchgestrichen, korrigiert und neu geschrieben. Seine Handschriften sind eruptive Ausbrüche in unterschiedlichen Farben, durchgekratztes Notenpapier – eine Arbeitsweise, der man den Widerstand der Musik an der Zeit förmlich ansehen kann. Beethoven hat keine Musik komponiert, er hat sie in die Welt gemeißelt.
Genau diese Kraft ist ein weiterer Mythos seines Werkes. Das revolutionäre Sprengen aller bis dahin bekannten Formen hat ihn zum Vorbild fast aller klassischen und romantischen, aber auch vieler moderner Musiker gemacht. Beethoven ist selbst für Popmusiker ein Idol geblieben. Es war nicht allein Chuck Berry, der ihm mit seinem Song „Roll over Beethoven“ ein musikalisches Denkmal setzte. Sogar die Beatles waren passionierte und musikalisch versierte Beethoven-Freaks. In „Because“ auf dem „Abbey Road“-Album von 1969 haben sie die „Mondscheinsonate“ drei Mal rückwärts aufgenommen, und auch in „Revolution 9“ auf dem „White Album“ bezogen sich die vier Pilzköpfe aus Liverpool auf die neun Symphonien des Meisters aus Bonn.
Aber wohl niemand hat der revolutionären Kraft Beethovens in der Moderne ein derart faszinierendes und destruktives Denkmal gesetzt wie Stanley Kubrick in seinem Film „A Clockwork Orange“: Der jugendliche Taugenichts Alex führt eine brutale Jugendbande an, wird zum Einbrecher und zum Mörder und soll schließlich mit der „Ludovico“-Technik gezähmt und resozialisiert werden. Durch die andauernde Beschallung mit Beethovens neunter Symphonie will man Alex zu einem besseren Menschen machen.
Beethovens Musik ist nicht nur Sinnbild bürgerlicher Revolution, sondern auch Propagandamittel politischer Macht. Beethoven selbst hat sich mit seiner dritten Symphonie, der „Eroica“, an Napoleon abgearbeitet, als der Franzose gerade für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit durch Europa wütete, sich selbst zum Kaiser krönte und schließlich von Wellington in Waterloo geschlagen wurde (auch diese Schlacht vertonte Beethoven auf eindrucksvolle Weise).
Als Österreichs Außenminister Metternich schließlich umgerechnet eine Milliarde Euro für die Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress bereitstellte, wurden davon nicht nur die Walzer von Johann Strauß gezahlt, sondern auch der musikalische Zeremonienmeister Ludwig van Beethoven, der Ehrenbürger Wiens, zu dessen politischen Auftraggebern unter anderen Zar Alexander I. von Russland, Preußen-König Friedrich Wilhelm II., der König von Schweden und Erzherzog Rudolph gehörten.
Symbol des weltoffenen Europas
Wie groß die politische Kraft Beethovens noch immer ist, hat Emmanuel Macron bewiesen, nachdem er zum französischen Präsidenten gewählt wurde und sich vor dem Pariser Louvre zu Beethovens neunter Symphonie, die mittlerweile zur Hymne Europas geworden war, feiern ließ. Für Macron ist Beethoven ein Symbol des humanistischen und weltoffenen Europas.
Die Nazis hingegen vereinnahmten den Komponisten auf andere Art: 1942 dirigierte Wilhelm Furtwängler Beethovens Neunte vor deutschen Kriegsinvaliden in Anwesenheit von Joseph Goebbels zu Adolf Hitlers Geburtstag – als Beweis der angeblichen Überlegenheit deutscher Kultur. Wie kann es sein, dass sich die Bedeutung der Musik Beethovens so radikal gewandelt hat, dass seine Werke sowohl von Faschisten als auch von Demokraten genutzt werden? Die Pianistin Gabriela Montero meint: „Beethovens Musik an sich ist unschuldig, aber jene, die sie benutzen, sind es nicht.“ Man könnte auch sagen: Beethovens Musik entfaltet eine derartige emotionale Kraft, dass jeder, der die Massen bewegen will, sich ihrer unmittelbaren Wirkung sicher sein kann.
Neben der lauten politischen Wirkung Beethovens gehört auch seine intime Seite zum Mythos des Komponisten. Kaum eine Frage bewegt die Beethoven-Forschung so sehr wie jene nach seinem Liebesleben. Wie kann es sein, dass das Genie keine Ehefrau fand? Wer war die wahre Elise? Und wer die unsterbliche Geliebte, der er einen seiner ergreifendsten Briefe widmete? Handelte es sich bei ihr um das Künstler-Groupie Bettina von Brentano oder um eine der Töchter von Gräfin Anna von Brunswick? Was wir wissen: Beethoven liebte und sehnte – und er amüsierte sich in den Bordellen Wiens. Sein „Brief an die unsterbliche Geliebte“ hat es sogar in die Kino-Popkultur gebracht –
in einer Bettszene in „Sex and the City“.
„Sprecht lauter! Schreit!“
Und dann ist da noch ein anderer Brief Beethovens, der Teil seines Mythos geworden ist. Im „Heiligenstädter Testament“ setzte er sich mit seiner Taubheit auseinander, formulierte seine Todessehnsucht und berichtete, dass er seinen Gesprächspartnern seit einiger Zeit vorgegaukelt hatte, dass er sie verstehen würde. Dabei würde er ihnen am liebsten entgegenrufen: „Sprecht lauter! Schreit!“ Beethoven war 31 Jahre jung, als er dieses Testament aufschrieb. Nicht auszuschließen, dass Werke wie die „Hammerklaviersonate“ oder die „Diabelli-Variationen“ auch deshalb entstanden sind, weil Beethoven sie sich nur vorgestellt hat; Werke, die zunächst nicht zum Spielen oder zum Hören gedacht waren, die lange als unspielbar galten – modernistische Hirngespinste eines tauben Genies.
Selbst Beethovens Tod ist von Mythen umrankt. Bauch und Füße waren durch ein Leberleiden geschwollen, mehrfach wurde ein Bauchschnitt angelegt, um Luft und Flüssigkeit entweichen zu lassen. Kurz vor seinem Tod wurde Beethoven noch eine Flasche Wein gebracht – als er sie sah, soll er seine letzten Worte gesprochen haben: „Schade, zu spät.“ Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass seine Leber durch den Alkoholkonsum auf die Hälfte des normalen Volumens geschrumpft war.
20.000 Menschen haben Beethoven auf seinem letzten Weg zum Wiener Ostfriedhof begleitet. Franz Schubert trug die Fackel, der Schriftsteller Franz Grillparzer schrieb die Trauerrede: „Erinnert Euch dieser Stunde und denkt: wir waren dabei, als sie ihn begruben, und als er starb, haben wir geweint.“ Zwei Mal wurde er noch exhumiert: 1863, um seinen Schädel zu vermessen und zu fotografieren, 1888, um ihn auf den Zentralfriedhof umzubetten. Was geblieben ist: Von Beethoven existieren mehr Bilder als vom damaligen Kaiser, die meisten sind von jener Maske inspiriert, die ihm an jenem Tag abgenommen wurde, an dem er schlechte Laune hatte. Nicht auszudenken, wie unser Beethoven-Bild ausgefallen wäre, hätte der Komponist an diesem Nachmittag gelacht.
Nur Kunst und Wissenschaft erhöhen den Mensch bis zur Gottheit