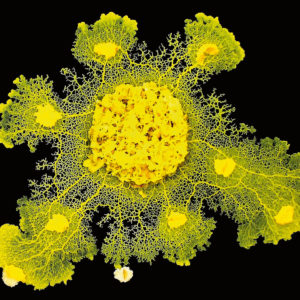Als er sein Leben erzählt, sitzt er im Garten seines Sommerhauses, das auf einem Hügel über St. Tropez liegt. Immer wieder blickt er hinunter zur blauen Küste der Côte d’Azur. Mario Adorf erinnert sich gerne – so lange, bis der Abend kommt und die Lichter in den Cafés und Bars zu glimmen beginnen. Dann zieht hier oben jedes Mal eine Stille auf, in die nur das Zirpen der Zikaden dringt. Es ist eine Stille, die nachklingt – ebenso wie die Worte Adorfs nachhallen, wenn er aufhört zu erzählen. Vor zwei Jahren ließ sich der Schauspieler darauf ein, an einem Film und einem Buch über sein Leben mitzuwirken. Den Film „Es hätte schlimmer kommen können“ hat Dominik Wessely mit ihm gedreht, er ist im August auf ARTE zu sehen. Ich durfte zuvor seine Lebensbilanz „Mario Adorf. Zugabe!“ (Kiepenheuer & Witsch) aufschreiben. In unseren Gesprächen erwähnte er oft das „große letzte Mal“. Er erzählte, wie er sich ausmalt, dass er Menschen, Orte und Dinge ein letztes Mal genießt. „Dieser Gedanke hat für mich nichts Trauriges, sondern es befriedigt mich sogar, diese Augenblicke bewusst zu empfinden.“
Etwas Unerklärliches
Schon immer umgab den Schauspieler etwas Unerklärliches. Jene typische Adorf-Aura, von der es heißt, er könne mit ihr einen Raum, den er gerade erst betreten hat, aus dem Stand heraus für sich einnehmen. Manchmal kommt es einem sogar so vor, als wäre seine Aura schon vor ihm da. Etwa, wenn er irgendwo entfernt spricht. Seine Stimme mit diesem Kaminknistern kündigt ihn dann schon von Weitem an. Und ergreift Besitz von einem.
Am 8. September wird Mario Adorf, zweifellos einer der größten deutschen Schauspieler, 90 Jahre alt. Er ist ein Weltstar, der nobel bestreitet, einer zu sein. Spricht man ihn an auf den Goldnugget, den er verborgen unter seinen Hemden an einer langen Halskette trägt, dann brummt er, dass der ihm „nichts weiter bedeute“. Denn das Glück, das war ihm auch ohne Talisman immer gewogen. Durch alle Zeiten.
Geboren in Zürich und aufgewachsen im Eifelstädtchen Mayen, nahm man Mario Adorf an der renommierten Münchner Otto Falckenberg Schule auf. Der Durchbruch kam 1957 mit „Nachts, wenn der Teufel kam“. Er glänzte in Schlöndorffs „Die Blechtrommel“ (1979) und vielen internationalen Filmen. Dafür lebte er lange in Rom. Und kehrte heim, um uns in „Kir Royal“ (1986) als Heinrich Haffenloher mit „seinem Geld zuzuscheißen“ und den Padrone in Helmut Dietls „Rossini“ (1997) zu geben. Er war „Der große Bellheim“ (1993) und „Der Schattenmann“ (1996). Letztgenannte Rolle mochte er besonders.
Vielleicht ist er selbst ein Schattenmann. Niemand anderes kann mit seinem Eifeler Wesen so machtvoll auf dem Erdboden fußen. Er lebt im Süden Frankreichs, aber auch in Paris und München. Er ist nicht bloß ein Schauspieler. „Ich bin ein Menschenspieler“, sagt er. „Mario und der Zauberer“ heißt eine Novelle von Thomas Mann. Wenn man das „und“ weglässt, beschreibt man Adorfs Wirkung ganz gut. Auch jene auf die Frauen seines Lebens. Glücklich verheiratet ist er in zweiter Ehe mit Brigitte Bardots Freundin Monique Faye. Sein schönstes Liebesglück, so verriet er vor Kurzem für das Buch, hat sich mit seinem Schulhof-Schwarm namens Elinor ereignet. „Ungetrübt und groß …“.
Wenn er nachts ganz allein durch seinen Garten spaziert, muss man sich manchmal vorstellen, wie diesen Mann von Kindesbeinen an eine Einsamkeit umgab. Denn seine geliebte Mutter – der italienische Vater hatte sich davongemacht – musste ihn unter der Woche ins Waisenhaus von Mayen geben. Als Näherin arbeitete sie Tag und Nacht, um den Buben durchzubringen.
Vielleicht behielt Mario Adorf ein Stück eben jener Einsamkeit lebenslang. Er verwandelte sie in eine seiner Stärken. Rainer Maria Rilke, von dem Adorf ein paar Gedichte rezitiert hat, schreibt: „Es ist gut, einsam zu sein, denn Einsamkeit ist schwer; dass etwas schwer ist, muss uns ein Grund mehr sein, es zu tun.“ Dass etwas schwer ist, war für Adorf immer ein Grund, es zu tun. Mit seiner „schweren Einsamkeit“, aber sicher auch mit einer eleganten Egozentrik brachte er es an eine im wahrsten Wortsinn einsame Spitze. Was er vermisst, sind wahre Freundschaften. „Sie zu pflegen, versäumte ich zeitlebens. Das war ein Fehler“, sagt er.
Mittags fährt Adorf gern hinunter zu seinem Lieblingsstrand von St. Tropez, wo ihm das Meer königsblau entgegenschwappt. Adorf summt dann ein paar Takte aus „Azzuro“, das macht er oft. Er schaut hinaus – und zurück. Bei ihm ist das wie im Kino. Immer läuft irgendwie ein Film ab.
Wenn man dann von ihm Abschied nehmen muss und sich das Tor vor seinem Haus öffnet, fühlt es sich an, als ob ein Vorhang fällt. Man umarmt einander und steigt in den Wagen. Schaut noch einmal in den Rückspiegel. Dort auf der Staße vor seinem Haus steht er. Hebt die Hand, winkt lange nach. Bis der Mann aus dem Rückspiegel verschwindet. Und doch bei einem bleibt.