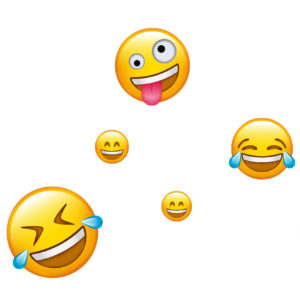Am Set arbeitet sie kompromisslos und behält nicht nur dank ihrer Körpergröße von 1,82 Metern stets den Überblick. Die US-Regisseurin Kathryn Bigelow tickt wie ein Uhrwerk: Präzise nimmt sie die Einstellungen auf – und lässt nicht locker, bis jede Szene perfekt im Kasten ist. Ihr Erfolgsrezept: nah heran ans Geschehen, bisweilen mit wackliger Handkamera filmen, rasante Schnitte. Und: keine erklärende Einordnung der Handlung oder des Hintergrunds, kein mahnender Zeigefinger – stattdessen pure, allenfalls homöopathisch dramatisierte Fakten, die das Publikum mitten ins Geschehen hineinziehen.
Als Bigelow 2010 einen Oscar für die beste Regie in „Tödliches Kommando“ gewann und sich sogar gegen ihren Ex-Ehemann James Cameron durchsetzte, der mit dem Blockbuster „Avatar“ als Favorit im Rennen lag, waren Kritiker und Studiobosse überrascht. Nicht nur, weil sie als erste Frau die begehrte Trophäe erhielt, sondern auch, weil ihr Film die verlustreichen Einsätze US-amerikanischer Bombenräumer in Bagdad kurz nach Saddam Husseins Sturz verhandelte – alles andere als oscarverdächtige Kost.
Die Ehe mit Cameron, der für ihren apokalyptischen Thriller „Strange Days“ (1995) das Drehbuch schrieb, mag ihre Produktionen beeinflusst haben, ihr Hang zur kompromisslosen Darstellung von Gewalt und Konflikten ist aber schon in ihren früheren Filmen wie „Near Dark“ (1987) erkennbar. Perfektioniert hat sie den Stil schließlich in „Zero Dark Thirty“ (2012), einer nervenaufreibenden Chronik der Jagd auf den Top-Terroristen Osama bin Laden. Abermals wurde sie dafür als Oscarkandidatin gehandelt, ging aber leer aus. Wohl auch, so meinten seinerzeit Hollywood-Insider, weil es in „Zero Dark Thirty“ um sogenannte Black Sites geht: geheime Foltergefängnisse des US-Geheimdienstes CIA.
Kämpferin für die gerechte Sache
Anschließend gönnte sich die heute 68-jährige Filmemacherin eine Auszeit. Erst 2017 legte sie nach und knöpfte sich in dem atmosphärisch dichten Polit- und Justizdrama „Detroit“ die Gewalttaten rassistischer Polizisten an Afroamerikanern während der Unruhen von 1967 vor. Der Film erhielt allerdings gemischte Kritiken. Zu unbekümmert hätten Bigelow und Filmautor Mark Boal mit den historischen Fakten jongliert, lautete der allgemeine Tenor.
„Rückblickend betrachtet würde ich das Thema heute wohl noch dokumentarischer angehen“, sagt Bigelow gegenüber dem ARTE Magazin. Seit den Krawallen von Detroit vor mehr als 50 Jahren habe sich in den USA zwar einiges getan in Sachen Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen. Systemischer Rassismus sei aber in der Gesellschaft noch immer vorhanden und müsse in Filmen häufiger zur Sprache kommen. „Angesichts der schrecklichen aktuellen Geschehnisse ist es derzeit jedoch kaum möglich, der Entwicklung auf fiktionale Weise gerecht zu werden“, sagt die Regisseurin mit Blick auf die jüngsten Unruhen nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd im Mai dieses Jahres.
Politisch brisante Stoffe will Bigelow dennoch weiterhin anpacken. So arbeitet sie seit geraumer Zeit an einem Film über das Schicksal von Bowe Robert Bergdahl – jenem ehemaligen US-Soldaten, der sich 2009 in Afghanistan von seiner Einheit entfernte, in die Hände der Taliban geriet und fünf Jahre später gegen eine Handvoll Guantánamo-Häftlinge ausgetauscht wurde. Das Thema erweist sich indes als zäh – auch weil viele Dokumente zu der Affäre unter Verschluss sind. Wann die Dreharbeiten beginnen werden, ist daher noch offen.
Nicht erst seit ihrem Oscargewinn macht sich die Regisseurin zudem für die Gleichberechtigung von Frauen in der Filmbranche und darüber hinaus stark, etwa mit Dokumentar-Kurzfilmen wie „Last Days“ (2014) und „I Am Not A Weapon“ (2018). „Einiges hat sich in den vergangenen Jahren bereits deutlich verbessert – auch dank #MeToo“, sagt Bigelow. „Das Studiosystem ist jedoch nach wie vor eine Männerdomäne. Der Kampf um gleiche Rechte geht daher selbstverständlich weiter.“