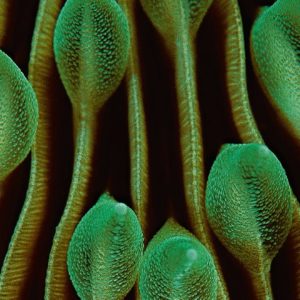Hinterher schien es manchen, als hätten sie in diesem Moment die Pforte zum Paradies gefunden. Den Weg zurück in den Garten Eden – „back to the garden“, wie Joni Mitchell 1970 in ihrem Lied „Woodstock“ sang: „By the time we got to Woodstock / We were half a million strong / And everywhere there was song and celebration.“ Eine halbe Million Menschen versammelte sich im August 1969 auf einem Feld im US-Bundesstaat New York, um „3 Days of Peace & Music“ zu feiern. So groß war der Ansturm, dass viele das Festivalgelände gar nicht erreichten; und von denen, die dort waren, konnten bei Weitem nicht alle die Musikerinnen und Musiker sehen, die sich auf der Woodstock-Bühne abwechselten. Doch war das nicht schlimm; denn was in diesem Moment zählte, war das überwältigende Gefühl der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, und die Erkenntnis, dass es von diesen Gleichgesinnten sehr viele gibt. „Früher waren wir nur wenige“, staunte Janis Joplin während ihres Festivalauftritts von der Bühne herunter, „jetzt gibt es Massen und Massen und Massen von uns.“ Und die Folksängerin Melanie feierte in ihrem gleichnamigen Song all die „beautiful people“, die an diesem Ort im Sommer 1969 zusammengekommen waren.
Woodstock: Das war ein utopischer Moment; ein Moment, in dem Pop zum Medium eines utopischen Versprechens wurde. Eine bessere Welt ist möglich, so lautete dieses Versprechen: eine Welt, in der alle so friedlich, harmonisch, liebevoll, offen und frei sein werden wie die Menschen, die sich an diesem Wochenende auf den Weiden des Bauern Max Yasgur versammeln. Und dass diese bessere Welt möglich ist – das wollte man in diesem Moment vor allem deswegen glauben, weil man sich unter „Massen und Massen und Massen“ von Menschen befand, die sich auf die gleiche Weise wie man selbst nach einer anderen Zukunft sehnten. Einer besseren.
Wie die zweiteilige ARTE-Dokumentation „Pop Utopia“ im Juli zeigt, hat Popmusik oft politische Botschaften verbreitet: Sie hat Ungerechtigkeit angeklagt und zum Kampf gegen Diskriminierung aufgerufen; sie hat Forderungen nach einem anderen Zusammenleben der Menschen, nach einer besseren Gesellschaft in griffige Formeln gebracht. Und sie hat – das ist vielleicht die wahre utopische Kraft, die ihr innewohnt – Menschen, die sich fremd und einsam fühlen in der Welt, das Gefühl gegeben, dass sie nicht alleine sind; dass es viele andere gibt, die so fühlen wie sie; dass sie Teil einer unsichtbaren Gemeinschaft sind. Und dass es irgendwo in dieser Welt einen Ort gibt, an dem diese Utopie zur Wirklichkeit werden kann. Sei es im neuen Garten Eden von Woodstock. Oder jenseits des Regenbogens.
Queere Emanzipationsbewegung
„Somewhere over the Rainbow“: So heißt eine
der großen utopischen Hymnen der Pop-Geschichte. Gesungen wird sie von Judy Garland 1939 in dem Film „Der Zauberer von Oz“; darin spielt sie das Mädchen Dorothy, das durch einen Wirbelsturm in das verzauberte Land Oz geschleudert wird. Dort trifft sie auf drei versehrte Gestalten – eine Vogelscheuche, einen ängstlichen Löwen und einen Zinnsoldaten –, mit denen sie so etwas wie eine neue Familie bildet. „Somewhere over the Rainbow“ wird in den 1950er und 1960er Jahren zur Hymne für schwule Männer und „Friends of Dorothy“ zu dem Code-Namen, den sie füreinander benutzen, weil ihre Sexualität noch weithin unter Strafe steht. Den Regenbogen, den Judy Garland besingt, erhebt die queere Emanzipationsbewegung später zu ihrem Symbol.
Dass sich die Liebe und das Begehren aus den engen Fesseln des Patriarchats und der heterosexuellen Norm befreien lassen, und dass sich niemand mehr davor fürchten muss, offen zu seiner Sexualität zu stehen – das hat seit je zu den großen Utopien des Pop gehört. Mit den sexuellen Emanzipationsbewegungen seit den 1960er Jahren ist er aufs Innigste verschwistert. Schon die Beatles überschreiten mit ihren Frisuren die klassischen Konventionen des Männlichseins. Damals ist dies ebenso ein Skandal wie später die langen Haare der männlichen Woodstock-Besucher. Anfang der 1970er inszeniert sich David Bowie als bisexuelles Alien Ziggy Stardust – und zeigt damit, dass es ein Leben jenseits eindeutiger sexueller Festlegungen gibt, und dass man sich überhaupt nicht auf jenes Geschlecht festlegen lassen muss, das einem von Geburt mitgegeben wird.
Viele schwule Männer, die in den 1970er Jahren ihre Jugend durchlebten, haben berichtet, wie der Anblick von Künstlern wie David Bowie ihnen bei ihrem eigenen Coming-out half; wie er das Bewusstsein dafür stärkte, dass sie mit ihrem „Anderssein“ nicht alleine sind, und ihnen damit Mut machte, zu sich selbst zu stehen. So liegt das utopische Moment von Pop auch hier darin, Gemeinschaften zu stiften – sei es auf ideelle Weise oder auf ganz konkrete. In den New Yorker Klubs, in denen ebenfalls Anfang der 1970er Jahre die Disco-Bewegung entstand, fanden
all jene Menschen, die ihre Sexualität nicht öffentlich zeigen durften, geschützte Räume – „safe spaces“, wie man heute sagt –, in denen Männer mit Männern tanzen konnten und Frauen mit Frauen. Und in denen Weiße, Latinos, Afroamerikaner, Menschen mit den unterschiedlichsten Hautfarben und Herkünften miteinander feierten und für die Dauer einer Party jenen Zustand wahr werden ließen, den es im Rest der Welt nur als Utopie gab und gibt: dass alle verschieden sein dürfen und dabei doch alle gleich sind.
„Why Can’t We Live Together“: Das ist der Titel eines frühen Disco-Hits aus dem Jahr 1972, gesungen und gespielt von dem Keyboarder Timmy Thomas: „No more war, no more war / all we want is some peace in the world“, heißt es darin, und weiter: „No matter, no matter what color / You are still my brother“. Auch Thomas beschwört die große Pop-Utopie, dass die Menschen in Frieden und Harmonie miteinander leben können, gleich welcher Hautfarbe, Herkunft oder Religion sie sind; und dass Diskriminierung und Hass sich eines Tages durch gegenseitigen Respekt ersetzen lassen. „Respect“ forderte die große Gospel- und Soulsängerin Aretha Franklin in einem Song, der (im Original von Otis Redding) 1967 zur Hymne des afroamerikanischen Civil Rights Movement wurde – und den später viele andere soziale Bewegungen übernommen haben. Aretha Franklin fordert Respekt für alle Menschen afroamerikanischer Abstammung; sie fordert in diesem Song aber auch Respekt für die Frauen – jenen Respekt, der ihnen von den Männern allzu oft nicht entgegengebracht wird.
Souverän, cool, feministisch
So ist Pop immer auch ein Medium weiblicher Emanzipation gewesen; davon zeugen große Gospel- und Soulsängerinnen wie bereits Billie Holiday und Nina Simone vor Aretha Franklin. Wobei es Frauen in den männlich geprägten Strukturen der Kulturindustrie bis heute nicht leicht gemacht wird, sich durchzusetzen und dabei mehr darzustellen als zarte Schönheiten oder Objekte für den sexualisierenden Blick. Dass erstmals eine Vielzahl von souveränen Musikerinnen gleichzeitig die Bühne betrat – das war der Punk-Bewegung zu verdanken, die Mitte der 1970er von den USA über Großbritannien auch nach Deutschland kam.
Hier fand man starke Frauen wie Patti Smith oder Debbie Harry, die Ende der 1970er Jahre mit ihrer Band Blondie zur feministischen Identifikationsfigur wurde. Mit ihrer kühlen, von jeglicher Zartheits- oder Verletzlichkeits-Pose weit entfernten Selbstinszenierung zeigte sie einer ganzen Generation junger Mädchen, wie man in einer von Männern geprägten Kultur zu einer souveränen Frau werden kann. Dabei fanden sich in den Songs von Blondie nicht einmal nennenswerte politische Slogans. Zur Ikone wurde Debbie Harry durch die Selbstverständlichkeit, mit der sie jene Aufmerksamkeit und Anerkennung für sich beanspruchte, die sonst nur Männern zuzustehen schien. Sie inszenierte sich gewissermaßen als lebendig gewordene Utopie: „How can one be a woman and not be a feminist? That’s my question“, lautet einer ihrer bis heute meistzitierten Aussprüche.
In Deutschland wird Nina Hagen zur Pionierin des weiblichen Punkrock; in ihren Songs kommen erstmals auch Themen wie der Kampf gegen die Abtreibungsgesetze vor. In „Unbeschreiblich weiblich“ besingt sie 1978 das Selbstbestimmungsrecht der Frauen über ihre Körper: „Ich war schwanger“, heißt es darin, „Ich wollt’s nicht haben / […] / Warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüll’n.“ Und 1986 erinnert sie im Duett mit Lene Lovich daran, dass die Utopie einer wahrhaft gerechten Welt erst dann zur Wirklichkeit werden kann, wenn die Gerechtigkeit auch für unsere Mitgeschöpfe, die Tiere, gilt: „Don’t Kill the Animals“, heißt dieser Song.
Die Utopie eines anderen Umgangs mit den Tieren, der Natur und der ganzen Schöpfung prägt den Pop ebenfalls schon seit den 1960er Jahren. In Westdeutschland nahm die Sängerin Alexandra 1968 das Gründungsdokument aller Öko-Songs auf: In „Mein Freund der Baum“ kündete sie mit wehmütig-bitterer Altstimme von dem Schmerz, der sie beim Anblick eines gefällten Baumes ereilte. In ähnlicher Weise klagte Joni Mitchell 1970 – in demselben Jahr, in dem sie auch den „Woodstock“-Song aufnahm – über die Zerstörungskraft der Zivilisation. „Sie planierten das Paradies und bauten einen Parkplatz darüber“, singt sie in dem Lied „Big Yellow Taxi“. Und sie beließ es nicht bei der Klage über die kommende Apokalypse: Im Oktober desselben Jahres gab sie mit Phil Ochs und James Taylor ein Benefizkonzert im kanadischen Vancouver, mit dessen Erlösen ein Protest gegen Atomwaffentests des US-Militärs in Alaska finanziert wurde – die erste Aktion einer jungen Umweltschutzbewegung namens „Greenpeace“.
So schließt sich hier der Kreis der Utopien, die sich im Pop widerspiegeln, von der Gleichberechtigung aller Menschen bis zu dem Wunsch, die Welt zu bewahren, in der die Menschen leben. Die Pforte, die zurück in das Paradies führt, scheint uns heute dabei so fest verschlossen wie vor 50 Jahren; die Hoffnungen, die der Pop schürt, erfüllen sich nur in kleinen Schritten – aber die Regenbögen, die er uns zeigt, leuchten weiter.
Warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüll’n