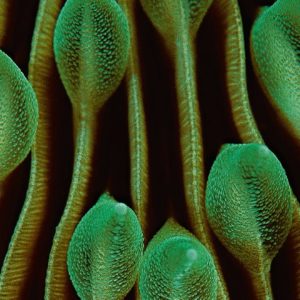Von außen sieht das Takara-Yu am Stadtrand von Tokio aus wie ein buddhistischer Tempel. Das spitze Dach mit an den Ecken angehobenen Traufbalken und die kunstvollen Holzornamente erinnern an die zahllosen Tempelanlagen im „Land der aufgehenden Sonne“. Doch ahnungslose Touristen, die hinter dem Eingangstor des Takara-Yu einen Gebetsaltar mit goldener Buddha-Statue vermuten, erwartet eine Überraschung: Sie finden keine religiösen Heiligtümer vor, sondern Dutzende nackte Japaner, die mit großer Selbstverständlichkeit ihrer täglichen Badehygiene nachgehen. Das Takara-Yu – zu Deutsch „Schatz“ – ist eines von Japans 5.000 öffentlichen Badehäusern. Allein in Tokio gibt es über 500 dieser sogenannten Sento. Eingepfercht zwischen gigantischen Wolkenkratzern, Shopping-Malls und blinkenden Billboards trotzen die traditionellen Bäder der rasanten Rundum-Modernisierung der Millionenmetropole. Anders als die auf dem Land verbreiteten Onsen, übersetzt „heiße Quellen“, haben die innerstädtischen Sento keinen spirituellen Charakter, sondern erfüllen in erster Linie einen profanen Zweck; Mann und Frau kommen hierher, um sich zu waschen und anschließend ein heißes Bad zu nehmen. Denn Körperhygiene, das zeigt die über 800 Jahre alte Geschichte der Sento, ist in der japanischen Tradition keine Privatangelegenheit, die hinter verschlossenen Türen stattfindet, sondern ein gemeinschaftliches Ritual. Die ARTE-Dokureihe „Badehäuser“ illustriert, wie in den Gepflogenheiten rund um das Saubermachen die vielfältigen Sitten und Bräuche unterschiedlicher Kulturen zum Ausdruck kommen. Die Japan-Folge veranschaulicht, wie der zunehmende Einfluss des Westens nicht nur die japanische Badekultur verändert hat, sondern auch das Verhältnis zum eigenen Körper und das damit verbundene Schamgefühl.
Vom Einzug der Scham in die Sento
Die ersten Sento um 1250 waren gewölbeartige Höhlen, ähnlich den heutigen Dampf- und Schwitzbädern. Anders als heute hielten Männer und Frauen sich in denselben Bädern auf. Einzelne Sento beschäftigten zudem Yuna (deutsch: „Bademädchen“), die den Gästen den Rücken schrubbten, die Haare wuschen und gelegentlich sexuelle Dienste anboten. Nacktheit galt als natürlich und war, wie auch die Sexualität, frei von Schuld oder Sünde. Das änderte sich, als sich Japan Mitte des 19. Jahrhunderts unter dem militärischen Druck der Vereinigten Staaten dem Westen öffnete. „Früher war es keine große Sache, dass man das andere Geschlecht nackt gesehen hat“, erzählt der japanische Kulturwissenschaftler Shinobu Machida. „Erst die Einführung der westlichen Kultur hat das verändert.“ Die amerikanischen Offiziere verschafften sich nicht nur Zutritt zu den japanischen Häfen, Städten und Märkten – sondern auch zu den Sento. Hier stellten sie fest, dass Männer und Frauen Seite an Seite badeten, ohne sich für ihre nackten Körper zu genieren. Mit diesem Bild untermauerten sie das Stereotyp der „unzivilisierten“ Ostasiaten, während die Gebräuche des Westens als vermeintlich fortschrittlicher Gegenentwurf galten.
Bis heute hat sich unter Japanerinnen und Japanern ein Verhältnis zu Körperlichkeit und Sexualität gehalten, das einem auf den ersten Blick unverblümt, bisweilen kindlich vorkommen mag. Es zeigt sich in Tokios florierender „Love Hotel“-Branche, in pornografischen Manga-Comics und shintoistischen Fruchtbarkeitskulten wie dem jährlichen „Fest des stählernen Penis“. Gleichzeitig sind Händchenhalten oder gar Schmusen in der Öffentlichkeit verpönt. Damals wie heute lassen sich die Japaner zwischen Permissivität und Prüderie nicht recht einordnen. Zu Teilen ist dieser Widerspruch auf den gesellschaftlichen Wandel der Meiji-Restauration (1868–1912) zurückzuführen. Was „normal“ war und was als „tabu“ galt, veränderte sich in diesen Jahrzehnten genauso rasant wie die Politik und die Industrie. Zu den neuen Tabus gehörte auch das Gemeinschaftsbad: Männer und Frauen sollten einander nicht mehr nackt sehen, geschweige denn gemeinsam baden. Das Takara-Yu öffnete 1927 seine Tore. Unterteilt in zwei Bereiche, lockte es Männer wie Frauen zum täglichen Bad. Die Geschlechtertrennung hat den Eigentümer allerdings vor ein Problem gestellt: Wer darf den einzigartigen Garten benutzen, der nur über eine Seite des Bades zugänglich ist? An dem Koi-Teich mit seiner Wasserfontäne aus Steinen des Fuji-Berges möchten alle gerne sitzen. Im Sinne der Gleichberechtigung hat das Takara- Yu für seine Gäste deshalb eine salomonische Lösung gefunden: Woche um Woche werden die Seiten getauscht, sodass Frauen und Männer abwechselnd in den Genuss der grünen Oase kommen.